Selbst schuld? Diese Angestellten drohen den Anschluss zu verlieren


Die Nutzung von KI sagt einiges über den Bildungsstand sowie den Arbeitsbereich aus, wie Forscher der Universität Konstanz in ihrer KI-Studie zeigen. Sie befürchten, dass Teile der Gesellschaft abgehängt werden können und fordern ein politisches Eingreifen.
Die Digitalisierung hat in der Arbeitswelt bereits zu massiven Umbrüchen geführt. Und mit jeder weiteren Entwicklung werden neue Änderungsprozesse in Gang gesetzt. Dabei könnte insbesondere der Einzug der Künstlichen Intelligenz ins Arbeitsleben drastische Konsequenzen nach sich ziehen, wie Forscher der Universität Konstanz in der KI-Studie 2025 nahelegen.
Denn die Nutzung der künstlichen Intelligenz nimmt bei der Arbeit nicht nur insgesamt zu. Im Vergleich zum letzten Jahr stieg sie um elf Prozent. Damit greifen nun etwa 35 Prozent der Beschäftigten auf KI-Werkzeuge bei der Arbeit zurück. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Nutzung von ChatGPT und damit das automatische Generieren von Texten. Doch auch spezialisierte Anwendungen, etwa in der Robotik, sind auf dem Vormarsch.
Bestimmte Berufsgruppen werden bei KI abgehängt
Das deutet bereits auf das große Problem hin, das mit dem Einzug der Technologie in die Arbeitswelt verbunden ist. Die größten Zuwächse bei der Nutzung von KI werden in Arbeitsgebieten verzeichnet, die ein hohes Maß an Wissen erfordern. In der Forschung, der IT und der Verwaltung wurde etwa ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr ermittelt. Rund 45 Prozent der Beschäftigten greifen in diesen Bereichen bereits auf Künstliche Intelligenz zurück, um sich die Arbeit zu erleichtern. Handwerkliche Berufe fallen im Vergleich dazu zurück. Hier stieg die KI-Nutzung im Laufe eines Jahres um lediglich vier auf nun 21 Prozent.
In dieser Entwicklung sehen die Konstanzer Wissenschaftler ein großes Problem. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Beschäftigte, die bereits Künstliche Intelligenz bei der Arbeit nutzen, auch die damit verbundenen Chancen eher optimistisch bewerten. Rund 43 Prozent der Angestellten in Büros erwarten demnach von KI positive Effekte auf ihre Arbeit. Bei Beschäftigten, die vorrangig händischen Tätigkeiten nachgehen, folgen lediglich 24 Prozent dieser Auffassung.
Werden bildungsferne Schichten abgehängt?
Mit Blick auf die Höhe des Bildungsabschlusses lassen sich ähnliche Tendenzen erkennen. Schon bei der im letzten Jahr durchgeführten KI-Studie zeigte sich, dass Absolventen einer Hochschule rund dreimal häufiger auf KI-Anwendungen bei der Arbeit zurückgreifen als Angestellte mit einem niedrigen Schulabschluss.
Die Forscher, die die KI-Studie erstellt haben, warnen dementsprechend davor, dass bereits Privilegierte viel stärker von den Chancen profitieren, die die neuen Technologien bieten. Insbesondere Angestellte im handwerklichen Bereich könnten dagegen von aktuellen Entwicklungen dauerhaft abgehängt werden. Diese Tendenz wird durch weitere Faktoren verstärkt. So ist die Bereitschaft, in entsprechende Stellen zu investieren, bei kleineren Unternehmen deutlich geringer als bei großen.
Nach Auffassung der Autoren der Studie besteht die Gefahr, dass so ganze Organisationen entstehen, die vom technologischen Wandel mehr und mehr abgekoppelt werden. Sie bieten ihren Beschäftigten dauerhaft schlechtere Chancen bei der individuellen Entwicklung, was letztlich zu gesellschaftlichen Spaltungstendenzen führen kann.









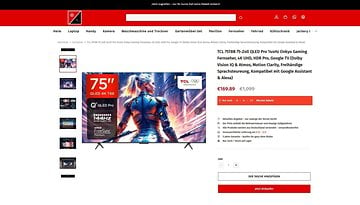









Ich kann die Sorgen der Wissenschaftler nicht ganz nachvollziehen. KI kann zwar Programme schreiben, Texte und Zeichnungen erstellen, Recherchearbeit erledigen usw., aber keine Fliesen legen, Rohre entstopfen, Wasserhähne und Steckdosen setzen oder Autos reparieren.
Wenn also KI bei der Kerntätigkeit dieser Berufe keinerlei Mehrwert bietet, darf es nicht wundern, wenn sie dort weniger zum Einsatz kommt. Ebenso wenig darf es wundern, wenn sich Angehörige dieser handwerklichen Berufe weniger Vorteile vom Einsatz von KI versprechen. In Randbereichen, z.B. bei der Kunden- und Terminverwaltung kann zwar auch in diesen Berufen KI zum Einsatz kommen, aber es bleiben eben Randbereiche. Da diese Berufe aber anderseits erst gefährdet sind, wenn Roboter diese Tätigkeiten zumindest assistierend übernehmen können, solche Roboter zu günstigen Preisen aber derzeit nicht in Aussicht stehen, hätte ich als Angehöriger eines Handwerksberufs eher weniger Sorgen, das Rentenalter in Brot und Arbeit zu erreichen, als in Büro- oder akademischen Berufen, in denen KI derzeit schon zum Einsatz kommt, und das Potential hat, immer größere Teile der Arbeit zu übernehmen. Handwerk hat eben doch einen goldenen Boden.